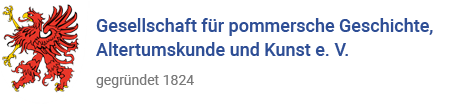Zur Gründung der Gesellschaft für Pommersche Geschichte
Am 15. Juni 1824 wurde die Gesellschaft für Pommersche Geschichte in Stettin gegründet. Ganz zeittypisch verstand sie sich als Vereinigung von „Freunden und Beförderern der Vaterlandskunde“. Ihre Mitglieder legten Wert auf den Meinungsaustausch, sei es im Rahmen von Tagungen oder rund um die regelmäßigen Vortragsveranstaltungen. Sechzig Jahre nach der Gründung zählte die Gesellschaft fast 500 Mitglieder und der Vorstand betonte: „Unser Verein ist keine Gesellschaft von Gelehrten, sondern von Freunden der pommerschen Geschichte und Altertumskunde, der Zutritt steht jedem Gebildeten frei“ – dabei ist es bis heute geblieben, zumal das eine das andere nicht ausschließt.
Die Gesellschaft bestand zunächst aus zwei „Ausschüssen“, die ihren Sitz in Stettin und in Greifswald hatten, womit den unterschiedlichen Traditionen und Gegebenheiten im bis 1815 schwedischen Neuvorpommern und dem brandenburg-preußischen Hinterpommern mit Altvorpommern Rechnung getragen wurde. In Stettin lenkte die Geschicke der Gesellschaft in den ersten Jahren Ludwig Giesebrecht (1792-1873), seit 1840 dann Johann Wilhelm Kutscher, in Greifswald war es Johann Gottfried Ludwig Kosegarten (1792-1860), dem 1865 Theodor Pyl folgte (1826-1904). In diesen Jahrzenhnten entfaltete die Gesellschaft eine umfassende Publikationstätigkeit, nicht nur durch ihr erstmals 1830 erschienenes Jahrbuch „Baltische Studien“, sondern auch in zahlreichen Einzeldarstellungen. Für kleinere Beiträge und Mitteilungen richtete die Gesellschaft 1887 die Monatsblätter der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde ein, die bis 1942 erschienen.
Nach den Vereinsstatuten von 1824 gehörte das Sammeln von Altertümern zu den vorrangigen Aufgaben der Gesellschaft, ein Auftrag, dem sie mit großem Eifer nachkam. Die Stettiner Sammlung der Gesellschaft war bald so umfangreich, daß sie 1879 in eigenen Räumen im Stettiner Schloß aufgestellt wurde. 1913 wurde sie im städtischen Museum auf der Hakenterasse untergebracht und schließlich im 1928 eröffneten Provinzialmuseum Pommerscher Altertümer. Heute können Teile der Sammlung noch immer am selben Ort, im Muzeum Narodowe bewundert werden. Die wenigen Sammlungsstücke, die die Gesellschaft noch nach dem Krieg in der alten Bundesrepublik besaß, übergab sie der Stiftung Pommern in Kiel, deren Sammlung später im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald aufging.
 In Greifswald hatte Kosegarten und besonders Theodor Pyl für die Gesellschaft eine umfangreiche Sammlung Vaterländischer Altertümer aufgebaut, die schließlich mit den Sammlungen der Universität verschmolz und noch heute Bestandteil der Ur- und frühgeschichtlichen Sammlung der Universität Greifswald ist. Die Bibliothek und das Archiv der Gesellschaft wurden 1902 im Staatsarchiv Stettin untergebracht und werden heute zum Teil dort, zum Teil im Landesarchiv Greifswald aufbewahrt.
In Greifswald hatte Kosegarten und besonders Theodor Pyl für die Gesellschaft eine umfangreiche Sammlung Vaterländischer Altertümer aufgebaut, die schließlich mit den Sammlungen der Universität verschmolz und noch heute Bestandteil der Ur- und frühgeschichtlichen Sammlung der Universität Greifswald ist. Die Bibliothek und das Archiv der Gesellschaft wurden 1902 im Staatsarchiv Stettin untergebracht und werden heute zum Teil dort, zum Teil im Landesarchiv Greifswald aufbewahrt.
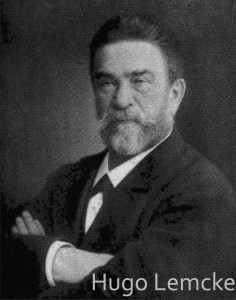 Nachdem in Stettin 1874 Hugo Lemcke (1835-1925) den Vorsitz der Gesellschaft übernommen hatte, wurde der bisherige Greifswalder Ausschuß in eine „Rügisch-pommersche Abtheilung“ umgewandelt. Sie hat sich 1899 in Form eines eigenständigen Vereins, des „Rügisch-Pommerschen Geschichtsvereins“ von der Gesellschaft getrennt und seit 1900 eine eigene Zeitschrift, die „Pommerschen Jahrbücher“ herausgegeben. Der „Rügisch-Pommersche Geschichtsverein“ wie auch sein Jahrbuch sind 1945 erloschen.
Nachdem in Stettin 1874 Hugo Lemcke (1835-1925) den Vorsitz der Gesellschaft übernommen hatte, wurde der bisherige Greifswalder Ausschuß in eine „Rügisch-pommersche Abtheilung“ umgewandelt. Sie hat sich 1899 in Form eines eigenständigen Vereins, des „Rügisch-Pommerschen Geschichtsvereins“ von der Gesellschaft getrennt und seit 1900 eine eigene Zeitschrift, die „Pommerschen Jahrbücher“ herausgegeben. Der „Rügisch-Pommersche Geschichtsverein“ wie auch sein Jahrbuch sind 1945 erloschen.
Unter Lemckes Vorsitz entfaltete die Gesellschaft mehr noch als zuvor ihre denkmalpflegerische Tätigkeit. Dabei wirkte die Gesellschaft auch eng mit der 1911 als Gremium hochqualifizierter Fachleute ins Leben gerufenen „Historischen Kommission für Pommern“ zusammen. Zeugnis über die Tätigkeit dieser Jahre legen die zahlreichen Inventare ab, die in der 1898 begründeten und im Auftrag der Gesellschaft herausgegebenen Reihe „Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Pommern“ veröffentlicht wurden und noch heute ein herausragendes wissenschaftliches Hilfsmittel darstellen.
Carl Fredrich (1871-1930) löste Lemcke 1923 im Amt ab und behielt es bis zu seinem Tode inne. Ihm folgte Otto Altenburg (1873-1950). Er trat, nach der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten mit dem gesamten Vorstand zurück. Die Gesellschaft wurde nun wie alle historischen Vereine veranlaßt, das sogenannte „Führerprinzip“ einzuführen. Mit einer stärkeren Anbindung an staatliche Dienststellen, etwa das Stettiner Staatsarchiv, dessen Direktoren (Erich Randt und später Adolf Diestelkamp) in den Folgejahren als Vorsitzende der Gesellschaft wirkten, meinte man dieser Forderung Genüge zu tun. Eine Satzungsänderung in diesem Sinne folgte 1935. Die Rahmenbedingungen für die Tätigkeit der Gesellschaft hatten sich insgesamt stark verändert und waren einer Ideologisierung unterworfen, die eine fruchtbare Entfaltung ihrer Tätigkeit im Sinne der ursprünglichen Vereinsziele immer seltener zuließ. Am Ende des zweiten Weltkrieges erlosch die Aktivität der Gesellschaft.
Es sollte fast ein Jahrzehnt dauern, bis die Gesellschaft am 15. Juni 1954 (ihrem alten Gründungstag) wiederbelebt wurde. Nun wurde auch die Pflege der modernen Kunst als satzungsmäßige Aufgabe formuliert und der Vereinsname entsprechend ergänzt. Die „Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst“ nahm ihren Sitz in Hamburg und sah ihre Aufgabe unter gänzlich veränderten Bedingungen in der „Förderung wissenschaftlicher, insbesondere historischer, prähistorischer, kunstgeschichtlicher, philologischer und volkskundlicher Arbeiten über Pommern“ und der „Veranstaltung von populärwissenschaftlichen Vorträgen und Ausstellungen“. Diese Vereinsziele sind bis heute in der Satzung der Gesellschaft festgeschrieben. Neben Hamburg bildeten sich weitere örtliche Zentren der Vereinsarbeit. So wurde 1955 eine Berliner Abteilung und 1956 die Bonner Abteilung der Gesellschaft gegründet. 1976 formierten sich die norddeutschen Mitglieder zur Hamburger Abteilung, die süddeutschen 1981 zur Münchener Abteilung. Diese historisch gewachsene Struktur des Vereins hat sich bis heute weitgehend erhalten. 1955 konnten erstmals wieder die Baltischen Studien erscheinen. Durch sie und durch ihr weitgestreutes Vortragsprogramm wirkte die Gesellschaft in diesen Jahren so gut es ging, zunächst unter dem Vorsitz von Carl Meister (+1974), ab 1961 dann von Hans Bernhard Reichow (1899-1974) und nach dessen Tod von Christopher von der Ropp (1904-1990). Ihm folgte 1976 Reinhart Berger (1910-1994) und 1986 Hellmut Hannes (*1925).
In seine Amtszeit fielen die großen politischen Veränderungen, die die deutsche Zweistaatlichkeit beendeten und der Gesellschaft eine Rückkehr nach Pommern ermöglichten. Viele persönliche Kontakte zu den Akteuren der landesgeschichtlichen Arbeit in Vorpommern waren in der Zeit der deutschen Teilung weitergepflegt worden, auch wenn „offizielle“ Beziehungen nicht möglich waren. Nun beschloß die Gesellschaft am 21. April 1990 eine Abteilung Vorpommern zu gründen, die auch bald unter der Leitung von Joachim Wächter ihre Tätigkeit aufnahm. Sie wurde dabei unterstützt von der 1971 gegründeten Arbeitsgemeinschaft für Pommersche Kirchengeschichte und den Organisatoren der seit 1985 durchgeführten Demminer Kolloquien. Damit war die Gesellschaft wieder in Pommern beheimatet. 1997 wurde der Sitz der Gesellschaft, deren Vorstand seit 1993 unter der Leitung von Ludwig Biewer arbeitet, nach Greifswald verlegt. Gleichzeitig trat sie die Rechtsnachfolge des einst aus ihr hervorgegangenen und inzwischen erloschenen „Rügisch-Pommerschen Geschichtsvereins“ an.